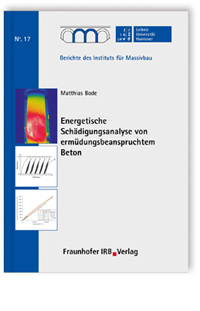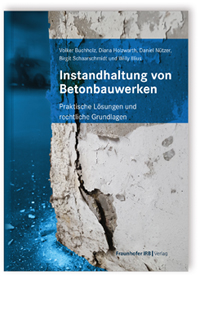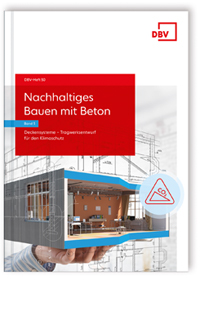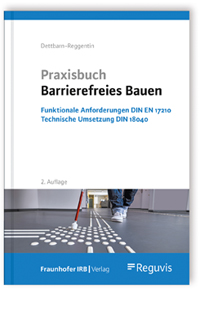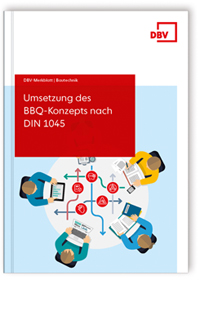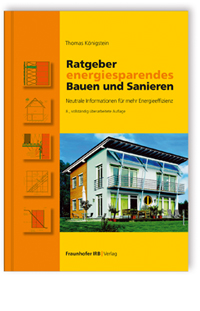Energetische Schädigungsanalyse von ermüdungsbeanspruchtem Beton (Softcover)
Details zur Dissertation
Autor
Matthias Bode
Erscheinungsjahr
2020
Herausgeber
Leibniz Universität Hannover, Institut für Massivbau, Nabil A. Fouad
Bibliografische Angaben
196 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
Softcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783738805888
Sprache
Deutsch
Aus den Spannungs-Dehnungslinien von kraftgeregelten Druckschwellversuchen lassen sich die Dissipationsenergiewerte bestimmen. Diese Dissipationsenergie ist für die Erwärmung der Probekörper infolge der zyklisch-mechanischen Beanspruchung verantwortlich. Auf Basis der festgestellten Korrelation zwischen der Probekörpererwärmung und der Schädigungsentwicklung wird nun die direkte Korrelation zwischen der Dissipationsenergie und der Rissentwicklung untersucht. Es zeigt sich, dass sich die Verläufe der mit jedem Lastwechsel dissipierten Energie analog zu den bereits bekannten Verläufen anderer Messparameter und Schädigungsindikatoren in drei Phasen aufteilen lassen. Aus der Auswertung der bis zum Versagen eines Probekörpers kumulierten Dissipationsenergie resultiert ein funktionaler Zusammenhang zur jeweiligen Bruchlastwechselzahl. Sämtliche Auswertungspunkte, die durch die Bruchlastwechselzahlen und den bis zum jeweiligen Versagen kumulierten Dissipationsenergiewerten beschrieben werden, liegen auf einer Kurve, die als Versagenskurve bezeichnet wird. Darauf aufbauend wird in dieser Arbeit ein neuer Schädigungsparameter eingeführt und ein neues Schädigungsmodell beschrieben.
- Kurzfassung
- Abstract
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
-
- Motivation
- Zielstellung
- Aufbau der Arbeit
- Stand der Forschung
-
- Betonermüdung
- Energetische Betrachtung des Materialverhaltens
- Dissipationsenergie
- Reibung von Beton
- Eigene Voruntersuchungen
-
- Beschreibung der experimentellen Untersuchungen
- Korrelation zwischen der Probekörpererwärmung und dem Schädigungsprozess
- Energetische Auswertung
- Hypothesen
- Dissipationsenergie als Schädigungsindikator
-
- Vorbemerkung
- Ermittlung der Dissipationsenergie
- Dissipationsenergie je Lastwechsel
- Probekörpererwärmung infolge der Energiedissipation
- Bewertung der Hypothesen
- Auswertung der kumulierten Dissipationsenergie
-
- Auswertung der Versuchsserien ZA
- Auswertung von zusätzlichen Versuchsserien
- Zusammenfassung der Auswertungsergebnisse
- Schädigungsmodell
-
- Einstufenversuche
- Mehrstufenversuche
- Anwendbarkeit bei weiteren sich verändernden Versuchsrandbedingungen
- Vergleich mit bisherigen Schädigungsmodellen
- Zusammenfassung und Ausblick
-
- Zusammenfassung
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Anhang