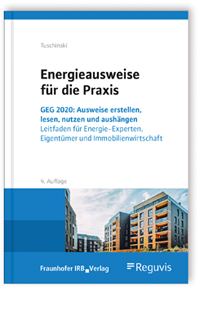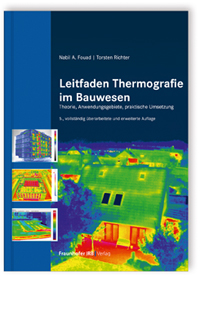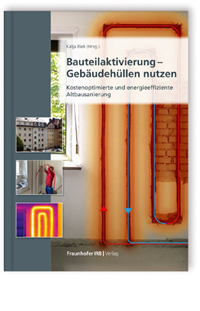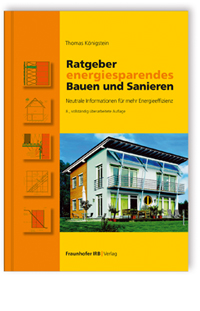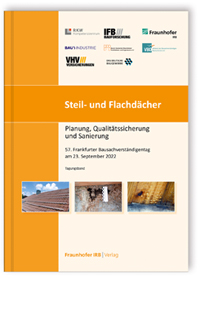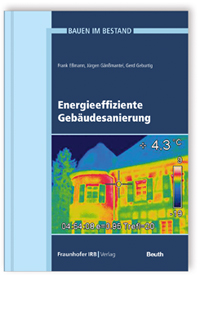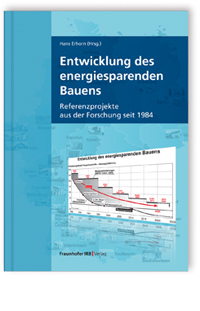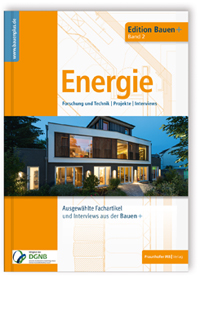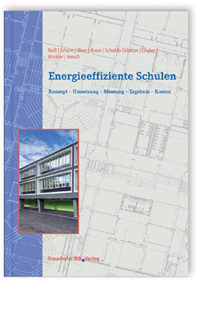Energieausweise für die Praxis (Softcover)
GEG 2020: Ausweise erstellen, lesen, nutzen und aushängen. Leitfaden für Energie-Experten, Eigentümer und Immobilienwirtschaft
Details zum Buch
Autor
Melita Tuschinski
Erscheinungsjahr
2022
Bibliografische Angaben
4., vollst. überarb. Aufl., 464 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
Softcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783738805628
Sprache
Deutsch
Seit dem 1. November 2020 gilt das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG 2020). Es bringt auch für Energieausweise viele Neuerungen. Das Praxisbuch geht detailliert darauf ein, z.B.:
- Ausstellungsberechtigung: Das Gesetz regelt, wer Energieausweise für Neubauten und bei Änderungen im Baubestand ausstellt. Bisher bestimmte dies das Baurecht des Bundeslandes.
- Energieausweismuster: Die EnEV regelte die Darstellung der Energieausweise in ihren Anlagen. Das GEG lagert die Muster aus. So können sie auch späteren Versionen des Gesetzes dienen.
- Gebäudeangaben: Im Energieausweis dokumentiert die Treibhausgasemission zusätzlich die Klimafreundlichkeit. Aussteller geben auch die Anzahl der inspektionspflichtigen Klimaanlagen und Termine für die Überprüfung an.
- Immobilienmakler: Sie legen den Energieausweis bei Verkauf und Neuvermietung den Interessenten vor und übergeben ihn nach Vertragsabschluss. Zudem veröffentlichen sie in ihren Anzeigen die verpflichtenden Angaben aus dem Energieausweis.
- Bußgeld und Kontrolle: Aussteller müssen vorsichtig mit den Eingabedaten sein. Das Gesetz regelt, was als ordnungswidrig gilt, und bestimmt die Höhe der Bußgelder.
Melita Tuschinski, Dipl.-Ing./UT, Freie Architektin, ist bekannt als Herausgeberin des Experten-Portals EnEV-online.de | GEG-info.de sowie als Autorin des Bestseller-Fachbuchs »EnEV und EEWärmeG parallel anwenden«. Ihr Portal schlägt mit Informationen und Antworten zu Praxisbeispielen - über 40 allein zum Energieausweis nach GEG 2020 - die Brücke von den rechtlichen Vorgaben zum Vollzug. Nach acht Jahren Lehre und wissenschaftlicher Mitarbeit an der Universität Stuttgart ist die Autorin seit 1996 selbstständig mit Büro in Stuttgart tätig und veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge und Publikationen.
- Vorwort
- Einleitung
- . Energieausweise für Gebäude
-
- Chancen und Grenzen der Gebäudeausweise
- Energiebedarfs- und Energieverbrauchsausweise
- Sechs Irrtümer zum Energieausweis
- Energieausweise in Europa
- . Gesetzliche Vorgaben des GEG kurzgefasst
-
- Grundsätzliches zum GEG
- GEG vereint die energiesparrechtlichen Regeln
- Ziele, betroffene Bauten und Verantwortliche
- Anforderungen an Neubauten
- Anforderungen im Baubestand
- Technik zum Heizen, Kühlen, Lüften, Wassererwärmen und Beleuchten
- Energieausweise für Neubau und Bestand
- Finanzielle Förderung für energieeffiziente Gebäude
- Vollzug der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis
- Besondere Bauten, Bußgelder und Anschlusszwang
- Übergangsvorschriften und Inkrafttreten
- Anlagen zum GEG
- Bekanntgemachte Arbeitshilfen
- . Vorgaben des GEG zum Energieausweis
-
- . Grundsätzliches und besondere Gebäude
- Anlässe zur Ausstellung von Energieausweisen
- Bedarfsausweis und Verbrauchsausweis für Gebäude
- Daten für die Energieausweiserstellung
- Modernisierungsempfehlungen im Energieausweis
- Angaben im ausgestellten Energieausweis
- Energieeffizienzklassen für Wohngebäude
- Angaben in kommerziellen Immobilienanzeigen
- Ausstellungsberechtigung für Energieausweise
- Muster für die Darstellung der Energieausweise
- Registriernummern für Energieausweise
- Stichprobenkontrollen von Energieausweisen
- Auswertung von Daten bei der Energieausweis-Kontrolle
- Bußgeldvorschriften zum Energieausweis
- Übergangsvorschriften für Energieausweise
- Übergangsvorschriften für Aussteller von Energieausweisen
- . Szenarien zum Energieausweis in der Praxis
-
- Neubau – Energieausweis für fertiggestelltes Gebäude
- Bestandsänderung – Energieausweis nach Sanierung der Gebäudehülle
- Bestandserweiterung – Energieausweis nach Anbau, Aufstockung oder Ausbau
- Verkauf oder Neuvermietung – Energieausweis für potenzielle Käufer, Neumieter, -pächter oder Leasingnehmer
- Aushang behördlich – Energieausweis für Besucher öffentlicher Gebäude
- Aushang privatwirtschaftlich – Energieausweis für Publikum und Kunden
- Sonderfälle – Ausnahmen von Energieausweisregeln
- Ausnahmen – kein Energieausweis erforderlich
- . Aufgaben und Akteure zum Energieausweis
-
- Energieausweis bestellen: Bauherr, Eigentümer, Verwalter und Aussteller
- Energieausweis ausstellen: Berechtigte Fachleute
- Energieausweis behördlich nutzen, aufbewahren, vorlegen, erneuern: Eigentümer und Landesbehörde
- Energieausweis für Immobilienanzeige auswerten: Auftraggeber für Anzeigen und Redakteure kommerzieller Medien sowie Interessenten
- Energieausweis vorlegen und übergeben: Verkäufer, Vermieter, Verpächter, Leasinggeber, Immobilienmakler sowie Käufer, neue Mieter, Pächter und Leasingnehmer
- Energieausweis ansehen, lesen und verstehen: Käufer, neue Mieter, Pächter und Leasingnehmer sowie Besucher
- Energieausweis vertragsrechtlich einbinden: Rechtsanwalt, Notar und Eigentümer
- Energieausweis öffentlich aushängen: Eigentümer, Mieter, Pächter und Leasingnehmer sowie Besucher
- Energieausweis behördlich überprüfen: Mitarbeiter der Kontrollstellen des DIBt und der Länder sowie Ausweisersteller und Eigentümer
- . Energieausweise ausstellen
-
- Ausstellungsberechtigte Fachleute für Energieausweise
- Regeln zur vereinfachten Ausstellung von Energieausweisen im Bestand
- Softwareprogramme zur Ausstellung von Energieausweisen
- Erste Schritte zur Ausstellung von Energieausweisen
- Energieausweise ausstellen für Wohngebäude
- Energieausweise ausstellen für Nichtwohngebäude
- Mögliche Fehlerquellen bei der Ausweiserstellung
- Abschließende Schritte zur Ausstellung von Energieausweisen
- Erstes Praxisbeispiel: Bedarfsausweis Wohngebäude
- Zweites Praxisbeispiel: Verbrauchsausweis Wohnbestand
- Drittes Praxisbeispiel: Bedarfsausweis Nichtwohnbestand
- Viertes Praxisbeispiel: Verbrauchsausweis Nichtwohnbestand
- Energieausweise für neue Wohnbauten nach Modellgebäudeverfahren (GEG-easy) erstellen
- . Perspektiven für Energieausweise
-
- Auf dem Weg zum klimaneutralen Europa
- Novelle der EU-Gebäuderichtlinie
- Klimapakt Deutschland für den Gebäudebereich
- Potenzial der Energieausweise ausschöpfen
- Energieausweise der nächsten Generation
- Ausblick für die Fachwelt und Immobilienwirtschaft
- . Literaturverzeichnis
- . Anhang