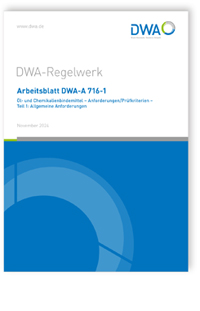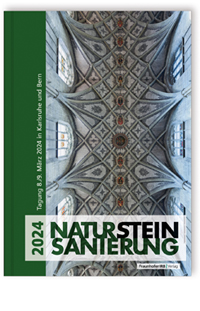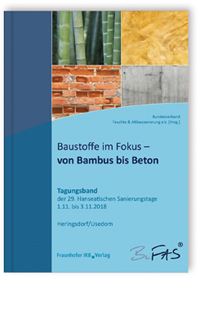Urban Mining Index (Softcover)
Entwicklung einer Systematik zur quantitativen Bewertung der Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen in der Neubauplanung
Details zur Dissertation
Autor
Anja Rosen
Erscheinungsjahr
2021
Bibliografische Angaben
344 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
Softcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783738806052
Sprache
Deutsch
Das Bauwesen ist national wie international die Branche mit dem höchsten Ressourcenverbrauch und Abfallaufkommen. Aufgrund der zunehmenden Ressourcenverknappung und Umweltbelastung ist es geboten, Baustoffe in möglichst geschlossenen, mit der Umwelt verträglichen (konsistenten) Kreisläufen zu führen.
Diesen Ansatz verfolgt das Urban Mining Design, indem das anthropogene Rohstofflager als "urbane Mine" gestaltet und bewirtschaftet wird. Hierfür muss die Kreislaufkonsistenz von Bauwerken als Entwurfsparameter begriffen werden.
In diesem Buch wird eine Systematik vorgestellt, mit der die Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen und Gebäuden in der Neubauplanung gemessen und bewertet werden kann: der Urban Mining Index. Hierfür wurden Parameter definiert, die die Materialität und die Konstruktion, aber auch die Wirtschaftlichkeit des selektiven Rückbaus abbilden, der Voraussetzung für die Rückgewinnung sortenreiner Wertstoffe ist.
Die zirkulären Baustoffe beziffern mit ihrem Anteil an der Masse aller im Lebenszyklus des Bauwerks verbauten Materialien das Gesamtergebnis: den Urban Mining Indicator.
Diesen Ansatz verfolgt das Urban Mining Design, indem das anthropogene Rohstofflager als "urbane Mine" gestaltet und bewirtschaftet wird. Hierfür muss die Kreislaufkonsistenz von Bauwerken als Entwurfsparameter begriffen werden.
In diesem Buch wird eine Systematik vorgestellt, mit der die Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen und Gebäuden in der Neubauplanung gemessen und bewertet werden kann: der Urban Mining Index. Hierfür wurden Parameter definiert, die die Materialität und die Konstruktion, aber auch die Wirtschaftlichkeit des selektiven Rückbaus abbilden, der Voraussetzung für die Rückgewinnung sortenreiner Wertstoffe ist.
Die zirkulären Baustoffe beziffern mit ihrem Anteil an der Masse aller im Lebenszyklus des Bauwerks verbauten Materialien das Gesamtergebnis: den Urban Mining Indicator.
Dr. Anja Rosen, Architektin und DGNB-Auditorin, promovierte 2020 mit dem „Urban Mining Index“ an der Bergischen Universität Wuppertal. Seit 2013 kombiniert sie ihre Lehr- und Forschungstätigkeit mit ihrer praktischen Arbeit und verantwortet aktuell als Co-Geschäftsführerin der energum den Bereich Nachhaltiges Bauen in der agn-Gruppe.
Anja Rosen ist Gründungsmitglied der re!Source Stiftung e.V. und setzt sich auch als aktives Mitglied der DGNB für eine Ressourcenwende in der Bauwirtschaft ein.
Anja Rosen ist Gründungsmitglied der re!Source Stiftung e.V. und setzt sich auch als aktives Mitglied der DGNB für eine Ressourcenwende in der Bauwirtschaft ein.
- . Motivation, Fragestellung und Ziele der Arbeit
-
- . Motivation
- . Übergeordnete Ziele
- . Fragestellung
- . Ziele dieser Arbeit
- . Strategie und wissenschaftliches Vorgehen
-
- . Strategien für eine nachhaltige Entwicklung
- . Ableitung der eigenen Strategie: konsistente Kreisläufe
- . Instrumente zur Verfolgung der Strategien für eine nachhaltige Entwicklung
- . Systemgrenzen
- . Wissenschaftliches Vorgehen
- . Status quo: Rückbau und Entsorgung im Bauwesen
-
- . Rechtliche Hintergründe
- . Abfallaufkommen und Verwertungsquoten
- . Rückbau- und Abbruchverfahren
- . Aufwand für Rückbau und Abbruch
- . Entwicklung des anthropogenen Rohstofflagers
- . Zwischenfazit
- . Bewertungsmethoden: Stand von Forschung und Technik
-
- . Recycling in der Gebäudezertifizierung
- . Recycling in der Produktzertifizierung
- . Bewertungsmethoden anderer Wissenschaftler – Stand der Forschung
- . Zwischenfazit
- . Parameter zur quantitaven Bewertung der Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen
-
- . Materielle Ebene
- . Konstruktive Ebene
- . Wirtschaftliche Ebene
- . Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Benchmarks für die Einordnung der ökonomischen Kriterien
-
- . Empirische Erhebung von Entsorgungskosten und -erlösen nach Wertstofffraktionen
- . Untersuchungen zum Rückbauaufwand am Beispiel von Fassaden- und Dachbekleidungen in Versuchsständen
- . Recherchen zum Rückbauaufwand auf Baustellen
- . Auswertung von Daten anderer Wissenschaftler zum Rückbauaufwand
- . Tabellarischer Bauteilkatalog
- . Berechnungsmethode zur systematischen Bewertung und Darstellung der Kreislaufpotenziale von Baukonstruktionen
-
- . Ebenen und Basis der Berechnung
- . Abbildung der Qualitätsstufen als Variable
- . Koeffizienten zur Berechnung der Kreislaufpotenziale
- . Überprüfung der Methodik und Verifizierung
- . Formeln zur Berechnung der Kreislaufpotenziale
- . Entwicklung eines Tabellenwerkzeugs zur systematischen Berechnung und Bewertung der Kreislaufpotenziale
- . Kreislaufpotenziale beispielhafter Konstruktionen im Vergleich
-
- . Modellprojekt 1
- . Modellprojekt 2
- . Zwischenfazit
- . Anwendung der Forschungsergebnisse auf Gebäudeebene in der Neubauplanung für das Modellprojekt »Rathaus Korbach«
-
- . Beschreibung des Projekts
- . Leitdetails für den Neubau – Variantenvergleich mit dem Urban Mining Index
- . Bewertung der Kreislaufpotenziale auf Gebäudeebene – der Urban Mining Indicator
- . Zwischenfazit
- . Fazit und Ausblick auf weitere Forschung
-
- . Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
- . Beitrag des Urban Mining Index im Forschungskontext zirkuläres Bauen
- . Verwendbarkeit der Forschungsergebnisse in verwandten Forschungsfeldern
- . Schlusswort
- Anhang
-
- Anlage 1 zu Kapitel 6.1: Aufstellung der Preiserhebung nach Wertstoffgruppen
- Anlage 2 zu Kapitel 6.4: Auswertung der Forschungsergebnisse von Graubner et al.
- Anlage 3 zu Kapitel 9.1.3: Pläne Rathaus Korbach
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Glossar