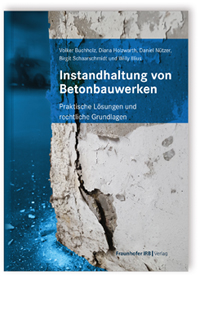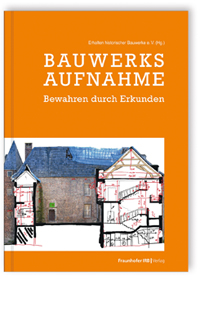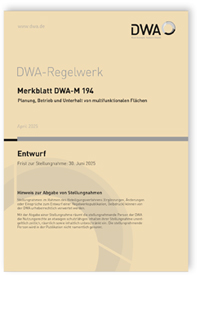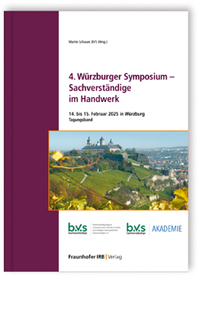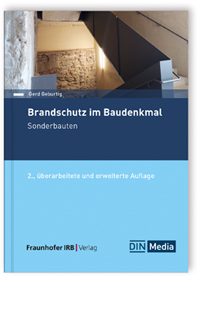Bauwerksanalyse (Softcover)
Details zum Buch
Reihe
Autor
Kornelia Horn
Erscheinungsjahr
2020
Herausgeber
Frank Eßmann, Jürgen Gänßmantel, Gerd Geburtig
Bibliografische Angaben
239 Seiten, 75 Abb., 30 Tab.
Softcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783816794820
Sprache
Deutsch
Die »Bauwerksanalyse« bildet die Grundlage für das Bauen im Bestand. Die Autorin bietet eine Einführung in die Arbeitsabläufe bei der Erfassung und der Bewertung von Bestandsgebäuden. Sie erläutert typische Schwachpunkte von Altbauten und stellt Untersuchungsverfahren zusammen, mit denen Schäden an Bauteilen aus Holz, Mauerwerk und Beton lokalisiert, Schadstoffbelastungen bestimmt und Schadensursachen ermittelt werden können. Mithilfe der im Buch enthaltenen Checklisten und Formblätter behalten Bauherren, Planer und Ausführende bei Sanierungs- sowie bei An- und Umbauprojekten von Anfang an den Überblick.
Mit dem vorliegenden dritten Band »Bauwerksanalyse« der Buchreihe »Bauen im Bestand« werden zusammenfassend die vielen verschiedenen Facetten und Möglichkeiten einer Bauwerksanalyse aufgezeigt. Ausgangspunkt sind die Regelwerke und Richtlinien zum Bauen im Bestand, hier insbesondere die aktuell vorliegenden WTA-Merkblätter.
Mit dem vorliegenden dritten Band »Bauwerksanalyse« der Buchreihe »Bauen im Bestand« werden zusammenfassend die vielen verschiedenen Facetten und Möglichkeiten einer Bauwerksanalyse aufgezeigt. Ausgangspunkt sind die Regelwerke und Richtlinien zum Bauen im Bestand, hier insbesondere die aktuell vorliegenden WTA-Merkblätter.
1979 bis 1983 Hochschulstudium, Fachrichtung Verfahrenstechnik; 1983 bis 2010 Mitarbeiterin in verschiedenen Unternehmen auf den Gebieten Magnetbandforschung, Umweltanalytik, Holz- und Bautenschutz; seit 2010 freiberuflich tätig (Ingenieur-Technische Leistungen).
Sachkundige für Holzschutz am Bau; Mitglied im WTA e. V. (Schriftleitung WTA-News)
Sachkundige für Holzschutz am Bau; Mitglied im WTA e. V. (Schriftleitung WTA-News)
„(…) Insgesamt ein Buch dass dem geneigten Leser einen kurz gefassten, aber umfassenden Überblick über Methodik und Verfahren der Bauwerksanalyse gibt und bei den Baubeteiligten hoffentlich das Bewusstsein für die unabdingbare Notwendigkeit einer an die jeweilige Bauaufgabe adaptierte Bauzustandsfeststellung und Bauwerksanalytik weckt.
(…)“ Marc Ellinger, 29. April 2020
- Vorwort
- Einleitung
- Erfordernis, Ziele und Ablauf der Bauwerksanalyse
-
- Erfordernis und Ziele der Bauwerksanalyse
- Ablauf der Bauwerksanalyse
- Schäden, Mängel und Schwachstellen an Bauwerken
-
- Grundsätzliches
- Zu den Begriffen Mangel und Schaden
- Mögliche Schadensursachen
- Schwachstellen und Schadenspunkte an Bauwerken
- Vorbereitung der Bauwerksanalyse
-
- Inhalte und Aufbau
- Einstiegsphase
- Vorplanung
- Ermittlung des Istzustands eines Bauwerks
-
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Orientierende Bauwerksbegehung
- Erkundungen zur Vorgeschichte des Bauwerks
- Die Bauaufnahme: Erfassung und Dokumentation
- Bestandsbeschreibung
- Beweissicherung
- Zustandserfassung und Schadensaufnahme
- Der Bauuntersuchungsplan
-
- Notwendigkeit der Untersuchungsplanung
- Vorgehen bei der Untersuchungsplanung
- Auswahl der Messtechnik und Prüfverfahren
- Beauftragung von Fachkundigen
- Bauwerksuntersuchungen – Aufgaben und Ziele
-
- Untersuchungsmethoden
- Baugrund- und hydrogeologische Erkundungen
- Untersuchung des konstruktiven Gefüges und des Tragsystems
- Bestimmung charakteristischer Baustoffeigenschaften
- Erfassung von Schadensmechanismen
- Monitoring (Langzeituntersuchungen)
- Weitere Untersuchungsaufgaben
- Untersuchungen am Bauwerk
-
- Überblick über Methoden und Geräte
- Strukturerkundung
- In-Situ Bestimmung von Baustoffeigenschaften
- Holztechnische Kontrollen
- Untersuchung auf Schadstoffbelastungen
- Monitoring
- Entnahme von Proben
-
- Notwendigkeit und Vorbereitung der Probenahme
- Entnahme von Bohrkernen, Bohrmehl, Handstücken
- Entnahme von Putz- und Mörtelproben
- Beprobung von Holzbauteilen
- Entnahme von Proben aus Hausstaub
- Entnahme von Proben aus der Raumluft
- Entnahme von Schimmelpilzproben
- Untersuchungen im Labor
-
- Überblick über Verfahren und Geräte
- Physikalische und chemische Verfahren
- Optische Verfahren
- Thermische Verfahren
- Bestimmung von Festigkeits- und Verformungskennwerten
- Feuchtetechnische Untersuchungen
- Chemisch-mineralogische Baustoffanalyse
- Quantitative Salzanalysen
- Mikrobiologische Untersuchungen
- Untersuchung auf Schadstoffbelastungen
- Holztechnische Laboruntersuchungen
- Auswertung, Beurteilung und Dokumentation der Untersuchungsergebnisse
-
- Auswertung und Beurteilung
- Dokumentation des Istzustandes
- Gegenüberstellung von Soll- und Istzustand
- Daten- und Schadensfallsammlungen
- Praktische Arbeitshilfen
-
- Vorbemerkungen
- Musterdokumente
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturnachweis
-
- Bücher und Zeitschriftenartikel
- Zitierte Normen, Richtlinien und Merkblätter
- Datenbanken
- Stichwortverzeichnis