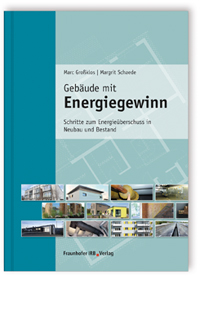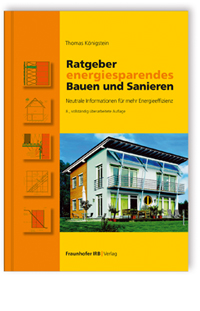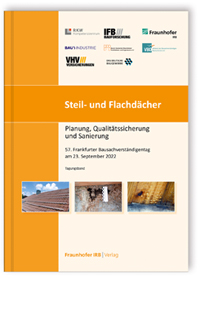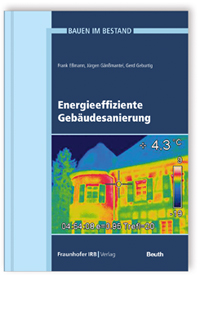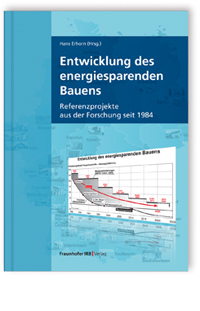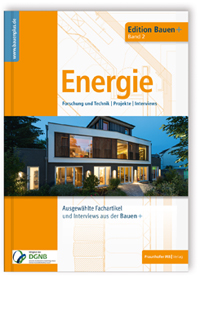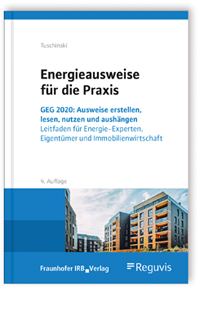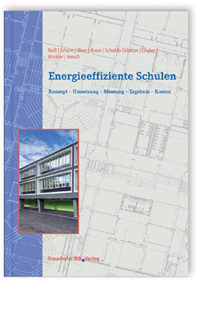Gebäude mit Energiegewinn (Hardcover)
Schritte zum Energieüberschuss in Neubau und Bestand
Details zum Buch
Autor
Marc Großklos, Margrit Schaede
Erscheinungsjahr
2016
Bibliografische Angaben
368 Seiten, 284 Abb., 53 Tab.
Hardcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783816796633
Sprache
Deutsch
Die Begriffe »Gewinn« und »Überschuss« bezeichnen einen Ertrag nach Abzug des Aufwandes und sind eigentlich Begriffe aus der Finanzwelt. Im Bauwesen beschreiben sie Gebäude, die mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen.
Das vorliegende Buch zeigt Ideen und Lösungen von Gebäuden mit Energiegewinn auf, konzentriert sich auf Wohngebäude (Neubauten und Sanierungsobjekte) und behandelt Gebäudegrößen vom Einfamilienhaus bis hin zum Mehrfamilienhaus.
Die Autoren gehen in der Reihenfolge und den Schritten vor, die auch ein Planer am konkreten Objekt geht. Deshalb wird zu Beginn analysiert, warum und wo Gebäude mit Energiegewinn vorteilhaft sind und aus welcher Motivation heraus sie gebaut werden. Die Autoren erläutern hierzu die Bilanzierung, leiten Empfehlungen für die Planung und Umsetzung ab und liefern Hinweise zur Reduzierung des Energiebedarfs. Darauf aufbauend wird betrachtet, wie der verbleibende Bedarf gedeckt und darüber hinaus ein Überschuss erzielt werden kann.
Die Bandbreite der umgesetzten Konzepte und die architektonischen Möglichkeiten werden am Ende des Buches in Form von mehreren realisierten Beispielgebäuden dargestellt.
Das vorliegende Buch zeigt Ideen und Lösungen von Gebäuden mit Energiegewinn auf, konzentriert sich auf Wohngebäude (Neubauten und Sanierungsobjekte) und behandelt Gebäudegrößen vom Einfamilienhaus bis hin zum Mehrfamilienhaus.
Die Autoren gehen in der Reihenfolge und den Schritten vor, die auch ein Planer am konkreten Objekt geht. Deshalb wird zu Beginn analysiert, warum und wo Gebäude mit Energiegewinn vorteilhaft sind und aus welcher Motivation heraus sie gebaut werden. Die Autoren erläutern hierzu die Bilanzierung, leiten Empfehlungen für die Planung und Umsetzung ab und liefern Hinweise zur Reduzierung des Energiebedarfs. Darauf aufbauend wird betrachtet, wie der verbleibende Bedarf gedeckt und darüber hinaus ein Überschuss erzielt werden kann.
Die Bandbreite der umgesetzten Konzepte und die architektonischen Möglichkeiten werden am Ende des Buches in Form von mehreren realisierten Beispielgebäuden dargestellt.
„(…) Unterstützt wird ihre praxiserprobte Kompetenz vom Verlag, indem er den eingeschlagenen Weg zu einer anschaulichen und großzügigen Darbietung der Inhalte auch mit diesem Band munter weitergeht. (…)“ Sacha Rufer in: Info-Bulletin (2016), Heft 50, Seite 10
- Gebäude mit Energiegewinn – eine umsetzbare Vision?
-
- Der Weg zum Ziel
- Energieüberschuss als Anreiz
- Offene Fragen im Zusammenhang mit Gebäuden mit Energiegewinn
- Der Blick über das Gebäude hinaus
- Von der Kohleheizung zum Energieüberschuss
- Bilanzierung von Gebäuden mit Energiegewinn
-
- Bewertungsgrößen und Bilanzgrenzen
- Weitere Aspekte der Bewertung von Gebäuden mit Energiegewinn
- Bilanzierungsverfahren
- Bewertungsfaktoren für Energieträger
- Interaktion des Gebäudes mit dem elektrischen Netz
- Definitionen und Standards für Gebäude mit Energiegewinn
- Empfehlungen für die Planung von Gebäuden mit Energieüberschuss
- Erster Schritt zum Energieüberschuss – die Reduktion des Energiebedarfs
-
- Heizenergie
- Warmwasserbereitung
- Wärmeverteilung
- Haushaltsstrom
- Hilfsenergie
- Nutzerverhalten
- Zweiter Schritt zum Energieüberschuss – Einsatz regenerativer Energien
-
- Wärmeerzeugung mit regenerativen Energiequellen
- Thermische Energiespeicher
- Stromerzeugung mit regenerativen Energien
- Elektrische Energiespeicher
- Optimierter Anlagenbetrieb
- Einflussgrößen auf den Energiegewinn von Gebäuden
-
- Vorstellung der Modellgebäude Neubau und Bestand
- Berechnungsverfahren
- Auswirkungen unterschiedlicher Randbedingungen auf die Energiebilanz
- Beispiele von Gebäuden mit Energiegewinn
-
- Neubau Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
- Neubau Einfamilienhaus mit Solarthermie
- Neubau Zweifamilienhaus
- Sanierung Einfamilienhaus
- Neubau Mehrfamilienhaus
- Sanierung Mehrfamilienhäuser
- Abkürzungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis