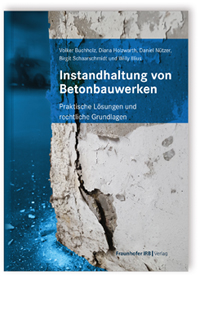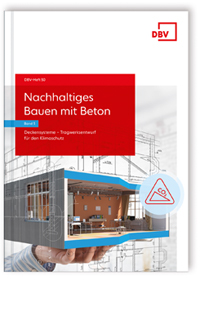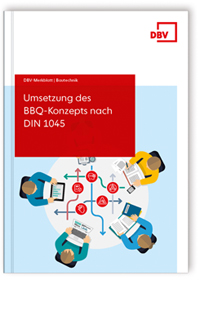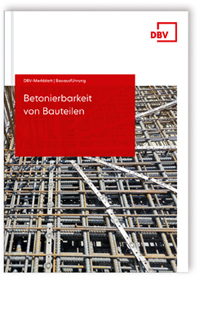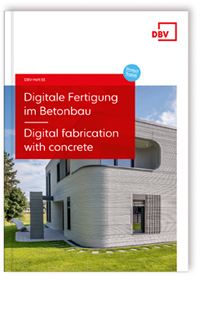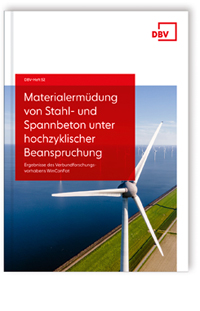Infraleichtbeton (Hardcover)
Entwurf, Konstruktion, Bau
Details zum Buch
Autor
Claudia Lösch, Philip Rieseberg, Alex Hückler
Erscheinungsjahr
2025
Herausgeber
Mike Schlaich, Regine Leibinger
Bibliografische Angaben
2., überarb. Aufl., 240 Seiten, 134 Abb., 31 Tab., 448 Formeln
Hardcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783738806694
Sprache
Deutsch
Infraleichtbeton ist ein zukunftsweisender Hochleistungsbaustoff mit großem gestalterischen Potenzial. Als Baustoff vereint er sowohl die tragende als auch wärmedämmende Funktion, wodurch Gebäude ohne eine zusätzliche Dämmschicht errichtet werden können. Das Bauen mit diesem monolithischen Material ist einfach, robust und langlebig – und damit eine kreislaufgerechte und nachhaltige Alternative zu den heute üblichen mehrschichtigen Wandaufbauten.
In der Praxis fehlen aber oft Kenntnisse zu Infraleichtbeton. Abhilfe bietet dieses Handbuch: Die Autorinnen und Autoren beschreiben nicht nur die bauphysikalischen Eigenschaften, sondern geben auch Hinweise zur Verarbeitung und zum Einsatz dieses neuartigen Werkstoffs. Dabei fließen sowohl erste Erfahrungswerte aus der Praxis als auch die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung ein. Detailzeichnungen unterstützen das Planen und Konstruieren. Projektbeispiele bieten Inspirationen für die eigenen Bauprojekte.
Vom materialgerechten Entwurf über die konstruktive Gestaltung bis hin zur Bemessung – mit diesem Leitfaden lässt sich das erste eigene Projekt mit Infraleichtbeton realisieren.
In der Praxis fehlen aber oft Kenntnisse zu Infraleichtbeton. Abhilfe bietet dieses Handbuch: Die Autorinnen und Autoren beschreiben nicht nur die bauphysikalischen Eigenschaften, sondern geben auch Hinweise zur Verarbeitung und zum Einsatz dieses neuartigen Werkstoffs. Dabei fließen sowohl erste Erfahrungswerte aus der Praxis als auch die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung ein. Detailzeichnungen unterstützen das Planen und Konstruieren. Projektbeispiele bieten Inspirationen für die eigenen Bauprojekte.
Vom materialgerechten Entwurf über die konstruktive Gestaltung bis hin zur Bemessung – mit diesem Leitfaden lässt sich das erste eigene Projekt mit Infraleichtbeton realisieren.
Herausgeber und Herausgeberin
Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich studierte Bauingenieurwesen und promovierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Er ist Partner im international tätigen Ingenieurbüro schlaich bergermann partner (sbp). Seit 2004 ist Mike Schlaich Professor an der Technischen Universität Berlin am Institut für Bauingenieurwesen und seit 2005 anerkannter Prüfingenieur für Baustatik. Er plant und realisiert weltweit Hochbauten und Brücken. Mike Schlaich wurde 2015 mit der Gold Medal der Institution of Structural Engineers, London ausgezeichnet und ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW).
Prof. Regine Leibinger studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und der Harvard University, USA. Sie führt seit 1993 gemeinsam mit Frank Barkow das Büro Barkow Leibinger. In der Zeit von 2006–2016 war Regine Leibinger Professorin für Baukonstruktion und Entwerfen an der Technischen Universität Berlin. Sie lehrte unter anderem an der Architectural Association in London, der Princeton University, School of Architecture, USA sowie an der Harvard Graduate School of Design in Boston, USA. Zahlreiche Projekte im In- und Ausland wurden mit Preisen ausgezeichnet.
Autoren und Autorin
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Claudia Lösch studierte in Karlsruhe, London und Aachen Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen. Nach mehrjähriger Tätigkeit in einem Ingenieurbüro arbeitete sie in den USA als beratende Ingenieurin in der Umweltschutztechnik. Von 2014 bis 2021 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau der Technischen Universität Berlin und forschte im Bereich des Infraleichtbetons. Seit 2021 arbeitet sie in der Forschung und Beratung zum Nachhaltigen Bauen.
Dipl.-Ing. Architekt Philip Rieseberg studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und der Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris. Gemeinsam mit Tarek Massalme und Jan Oliver Kunze führt er seit 2008 das Büro Studio MARS in Berlin. Von 2014 bis 2017 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Baukonstruktion und Entwerfen der Technischen Universität Berlin und forschte im Bereich des Infraleichtbetons. Seit 2024 unterrichtet er an der Dessau International Architecture Graduate School, Hochschule Anhalt in Dessau.
Prof. Dr.-Ing. Alex Hückler studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin. Er erwarb internationale Erfahrungen als Offshore Ingenieur im Engineering Consulting der Öl- und Gasindustrie und arbeitete als Tragwerksplaner im Brücken- und Hochbau. Zwischen 2010 und 2024 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau der Technischen Universität Berlin und forschte zum Trag- und Verformungsverhalten von Bauteilen aus Infraleichtbeton und Carbonbeton. 2024 wurde er zum Professor für Massivbau und Statik an der Berliner Hochschule für Technik (BHT) ernannt.
Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich studierte Bauingenieurwesen und promovierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Er ist Partner im international tätigen Ingenieurbüro schlaich bergermann partner (sbp). Seit 2004 ist Mike Schlaich Professor an der Technischen Universität Berlin am Institut für Bauingenieurwesen und seit 2005 anerkannter Prüfingenieur für Baustatik. Er plant und realisiert weltweit Hochbauten und Brücken. Mike Schlaich wurde 2015 mit der Gold Medal der Institution of Structural Engineers, London ausgezeichnet und ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW).
Prof. Regine Leibinger studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und der Harvard University, USA. Sie führt seit 1993 gemeinsam mit Frank Barkow das Büro Barkow Leibinger. In der Zeit von 2006–2016 war Regine Leibinger Professorin für Baukonstruktion und Entwerfen an der Technischen Universität Berlin. Sie lehrte unter anderem an der Architectural Association in London, der Princeton University, School of Architecture, USA sowie an der Harvard Graduate School of Design in Boston, USA. Zahlreiche Projekte im In- und Ausland wurden mit Preisen ausgezeichnet.
Autoren und Autorin
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Claudia Lösch studierte in Karlsruhe, London und Aachen Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen. Nach mehrjähriger Tätigkeit in einem Ingenieurbüro arbeitete sie in den USA als beratende Ingenieurin in der Umweltschutztechnik. Von 2014 bis 2021 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau der Technischen Universität Berlin und forschte im Bereich des Infraleichtbetons. Seit 2021 arbeitet sie in der Forschung und Beratung zum Nachhaltigen Bauen.
Dipl.-Ing. Architekt Philip Rieseberg studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und der Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris. Gemeinsam mit Tarek Massalme und Jan Oliver Kunze führt er seit 2008 das Büro Studio MARS in Berlin. Von 2014 bis 2017 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Baukonstruktion und Entwerfen der Technischen Universität Berlin und forschte im Bereich des Infraleichtbetons. Seit 2024 unterrichtet er an der Dessau International Architecture Graduate School, Hochschule Anhalt in Dessau.
Prof. Dr.-Ing. Alex Hückler studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin. Er erwarb internationale Erfahrungen als Offshore Ingenieur im Engineering Consulting der Öl- und Gasindustrie und arbeitete als Tragwerksplaner im Brücken- und Hochbau. Zwischen 2010 und 2024 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Entwerfen und Konstruieren – Massivbau der Technischen Universität Berlin und forschte zum Trag- und Verformungsverhalten von Bauteilen aus Infraleichtbeton und Carbonbeton. 2024 wurde er zum Professor für Massivbau und Statik an der Berliner Hochschule für Technik (BHT) ernannt.
- Theoretische Grundlagen
- Definition und Einordnung von Infraleichtbeton
- Gestalterisches Potenzial des Materials
- Materialtechnologie
- Zusammensetzung
- Klassifizierung
- Eigenschaften
- Gebäudetypologien
- Baukonstruktive Leitdetails
- Grundlagen der Planung
- Parametertabelle zur statischen Vorbemessung
- Bauphysikalische Eigenschaften
- Nachhaltigkeit
- Rechtliche Grundlagen
- Bemessungsansätze zur Tragwerksplanung
- Grundlagen der Bemessung
- Dauerhaftigkeit
- Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit
- Bemessung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
- Konstruktionsgrundlagen
- Baupraktische Aspekte
- Geeignete Schalungen
- Oberflächengestaltungen
- Herstellung und Einbau
- Oberflächenschutz
- Betonkosmetik und Nachbearbeitung
- Ausgewählte Bauwerke
- Beispielhafte Bemessungen