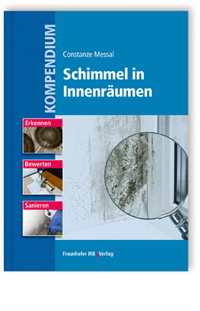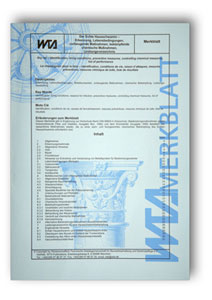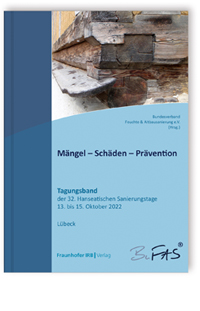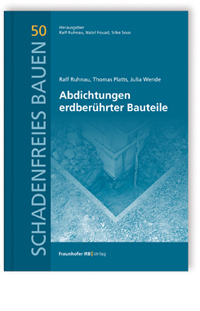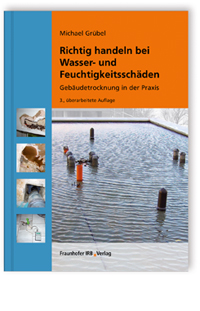Kompendium Schimmel in Innenräumen (Hardcover)
Erkennen, Bewerten und Sanieren
Details zum Buch
Autor
Constanze Messal
Erscheinungsjahr
2018
Bibliografische Angaben
304 Seiten, 280 Abb., 24 Tab., 30 Graf.
Hardcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783816793137
Sprache
Deutsch
Schädliche Mikroorganismen in Innenräumen gefährden die menschliche Gesundheit und zerstören Baustoffe. Frau Messal vermittelt umfassend und fundiert die Sachkunde zu Schimmelpilzbefällen in Innenräumen. Sie erläutert alle Schritte zur Erstellung eines Schadensgutachtens von der fachkundigen Probenentnahme über die mikrobielle Diagnostik, die relevanten chemisch-physikalischen Untersuchungsverfahren bis zur Interpretation der Befunde. Bei Schimmelschäden sind außer Schimmelpilzen meistens auch Bakterien, Milben und Protozoen im Spiel. Die Bewertung des Schadensausmaßes hängt darüber hinaus von den Anforderungen an die Innenraumhygiene ab, die im »Schimmelleitfaden« des Umweltbundesamtes neu definiert wurden. Die Autorin erläutert die gesundheitlichen Aspekte sichtbarer und versteckter Schadensbilder. Sie diskutiert kritisch den aktuellen UBA-Leitfaden und geht auf rechtliche Aspekte ein, die sich oftmals aus Schimmelschäden ergeben. An Beispielen erläutert sie die Sanierung mikrobieller Schäden, beginnend bei Erstmaßnahmen, der Baustellenplanung über die Ausführung bis zur Nachuntersuchung. Dabei wägt sie alternative Sanierungstechniken ab und geht auch auf das wichtige Thema Arbeitsschutz ein. Möglichkeiten der Schimmelprophylaxe bei Neu- und Wiederaufbau vervollständigen den Maßnahmenkatalog.
Das »Kompendium Schimmel in Innenräumen« ist auch geeignet für die Qualifizierung zum Sachkundigen für das Erkennen, Bewerten und Sanieren von Schimmelpilzschäden in Innenräumen mit dem Schwerpunkt Holz- und Bautenschutz.
Das »Kompendium Schimmel in Innenräumen« ist auch geeignet für die Qualifizierung zum Sachkundigen für das Erkennen, Bewerten und Sanieren von Schimmelpilzschäden in Innenräumen mit dem Schwerpunkt Holz- und Bautenschutz.
Frau Dr. rer. nat. Constanze Messal ist Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der "MICOR Gesellschaft für mikrobielle Prozesse und Materialkunde mbH" in Rostock. Zudem ist sie Sachverständige an der IHK Rostock für Mikrobielle Materialzerstörung und Materialschutz und leitet beim Deutschen Holz- und Bautenschutzverband DHBV den Fachbereich "Schimmelpilze".
„(…) dieses Buch hält mehr als der Titel verspricht, zu einem angemessenen Preis. (…)“ Norbert Faßhauer, 18. September 2018
„(…) lesenswerte Publikation (…) welche allen uneingeschränkt zu empfehlen ist, die sich mit der Erkennung, Untersuchung, Beurteilung und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen befassen. (…)“ Prof. Dr. Klaus Fiedler in Wohnmedizin (2018), Heft 3, Seite 142
„(…) lesenswerte Publikation (…) welche allen uneingeschränkt zu empfehlen ist, die sich mit der Erkennung, Untersuchung, Beurteilung und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Innenräumen befassen. (…)“ Prof. Dr. Klaus Fiedler in Wohnmedizin (2018), Heft 3, Seite 142
- Vorwort
- Einleitung
-
- Zum Gebrauch dieses Buchs
- Grundlagen
-
- Mikroorganismen und ihre Lebensweise (Grundlagen)
- Protozoen, Nematoden, Milben
- Warum es Schimmelpilze im Innenraum so leicht haben
- Andere Innenraumschadstoffe
- Ursachen von Feuchteschäden
-
- Wasserschäden: Lecks in der Installation, Hochwasser, Fäkalwasser
- Bauschäden und Mängel als Ursache
- Kondensat und Bauteiloberflächentemperaturen
- Nutzerverhalten
- Neubaufeuchte
- Schadensbilder erkennen, Schäden suchen
-
- Sichtbare Schimmelschäden
- Befallsbild MCF
- Versteckte Schäden suchen
- Wohnräume
- Räume mit besonderen Anforderungen
- Schimmel auf Holzkonstruktionen
- Historische Bauwerke und Kirchen
- Sonderfall Biokorrosion
- Mikrobielle Diagnostik und Probennahmestrategie
-
- Mikrobielle Analyseverfahren
- Physikalisch-chemische Verfahren
- Probennahmestrategie
- Bewertung von Schäden
-
- Richtgrößen und Kontrollwerte
- Feststellung der Sanierungsdringlichkeit
- Abgrenzung unterschiedlicher Bewertungsszenarien
- Gesundheitliche Aspekte bei der Schadensbewertung
- Sanierung von mikrobiellen Schäden
-
- Verantwortlichkeiten
- Sanierungsplanung und Festlegen des Sanierungsziels
- Erstmaßnahmen
- Vorgaben für den Arbeitsschutz
- Erstellen der Gefährdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung mithilfe der DGUV-I 201-028
- Schutzmaßnahmen nach DGUV-I 201-028
- Einrichtung des Sanierungsbereichs und flankierende Maßnahmen
- Sanierungsverfahren
- Sanierungskontrolle
- Sonderverfahren zur Sanierung von Schimmelschäden an Holz und Holzwerkstoffen
- Sonderverfahren: Biozidbehandlung von schimmelbelasteten Bauteilen
- Wiederaufbau
-
- Bauteiltrocknung
- Schimmelresistente Materialien
- Lüftung
- Berichte schreiben, Gutachten lesen
-
- Anforderungen an Baustellenprotokoll, Bericht und Gutachten
- Gutachten lesen
- Glossar
- Anhang
-
- Übersicht über die Normenreihe 16000
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis