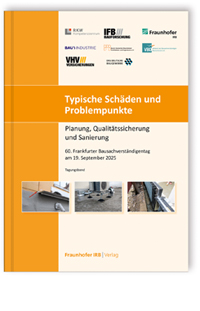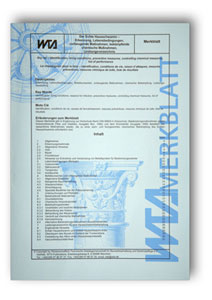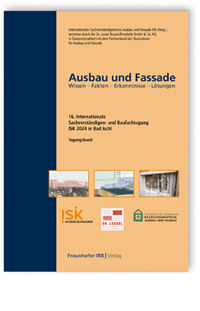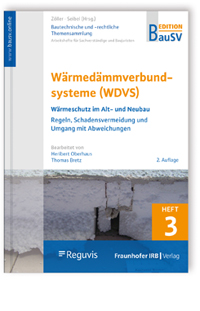Schäden an Holzfußböden (Hardcover)
Reihe begründet von Günter Zimmermann
Details zum Buch
Reihe
Schadenfreies Bauen , 29
Autor
Andreas O. Rapp, Bernhard Sudhoff
Erscheinungsjahr
2020
Herausgeber
Ralf Ruhnau
Bibliografische Angaben
3., aktual. Aufl., 276 Seiten, 176 Abb., 24 Tab.
Hardcover
Fraunhofer IRB Verlag
ISBN 9783738804294
Sprache
Deutsch
Holzfußböden haben für das Bauen nach wie vor eine große Bedeutung. Viele Bauherren besitzen eine Vorliebe für natürliche Baustoffe und schätzen die technischen Eigenschaften von Holzfußböden ebenso wie deren Ästhetik. Nicht selten aber kommt es zu Auseinandersetzungen, weil sich an den Böden Schäden zeigen. Der häufigste Grund für Mängel und Schäden liegt darin, dass beim Planen und Verlegen gegen technische Regeln verstoßen wird und spezifische Eigenschaften des Holzes nicht beachtet werden. In diesem Buch zeigen die Autoren das ganze Spektrum möglicher Fehlerquellen auf.
Die dritte Auflage des bewährten Ratgebers bietet eine vollständig aktualisierte Darstellung der technischen Regeln für das Planen und Verlegen von Holzfußböden. Die Autoren analysieren typische Schadensbilder. Sie beschreiben, mit welchen Methoden Schadensursachen nachträglich ermittelt werden können und wie sich Mängel und Schäden sicher vermeiden lassen. Ihr Buch ist für Sachverständige, Parkettleger und Hersteller ebenso nützlich wie für Bauherren, Immobilienbesitzer, Vermieter und Mieter von Räumlichkeiten mit Holzfußböden.
Die dritte Auflage des bewährten Ratgebers bietet eine vollständig aktualisierte Darstellung der technischen Regeln für das Planen und Verlegen von Holzfußböden. Die Autoren analysieren typische Schadensbilder. Sie beschreiben, mit welchen Methoden Schadensursachen nachträglich ermittelt werden können und wie sich Mängel und Schäden sicher vermeiden lassen. Ihr Buch ist für Sachverständige, Parkettleger und Hersteller ebenso nützlich wie für Bauherren, Immobilienbesitzer, Vermieter und Mieter von Räumlichkeiten mit Holzfußböden.
Prof. Dr.-Ing. Andreas O. Rapp (Jahrgang 1962), Lehre im Parkettlegerhandwerk, Abschluss 1984 als 1. Bundessieger, 1989 Meisterprüfung. 1988 Dipl.-Holz-Ing. FH-Rosenheim. 1993 Diplom-Holzwirt Universität Hamburg. 1993-2007 Wissenschaftler an der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft und Dozent an der Universität Hamburg. Seit 1994 ö.b.u.v. Sachverständiger für Parkett. Seit 2007 Professor für Holztechnik und Didaktik an der Leibniz Universität Hannover und Leiter des Instituts für Berufswissenschaften im Bauwesen. 2013 Begründung der optischen Bau-Forensik als Forschungsdisziplin und Methode zur Aufklärung von Bauschäden.
Dr.-Ing. Bernhard Sudhoff (Jahrgang 1953), Parkettlegermeister, Restaurator im Parkettlegerhandwerk und ö.b.u.v. Sachverständiger. 1976 bis 1982 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Dortmund, 1982 bis 1985 Planung und Bau verfahrenstechnischer Anlagen. Von 1985 bis 2019 Geschäftsführer einer Parkettfabrik und eines Handwerksbetriebes für die Verlegung von Holzfußböden.
Dr.-Ing. Bernhard Sudhoff (Jahrgang 1953), Parkettlegermeister, Restaurator im Parkettlegerhandwerk und ö.b.u.v. Sachverständiger. 1976 bis 1982 wissenschaftlicher Assistent an der Universität Dortmund, 1982 bis 1985 Planung und Bau verfahrenstechnischer Anlagen. Von 1985 bis 2019 Geschäftsführer einer Parkettfabrik und eines Handwerksbetriebes für die Verlegung von Holzfußböden.
Aus dem Inhalt:
Holz als Werkstoff für FußbödenStruktur und allgemeine Eigenschaften
Holzartspezifische Eigenschaften
Entwicklung und Arten der HolzfußbödenEntwicklung der Holzfußböden
Arten der Holzfußböden
Beanstandung – Mangel – SchadenSchaden und Mangel
Mangel und Beanstandung
Unregelmäßigkeiten bei Holzfußböden
Schadensbilder aus der PraxisFugen
Risse
Unregelmäßige Oberfläche
Verfärbungen
WertminderungMinderung bei Mängeln
Funktionsanalyse
Nutzungsdauer
Holz als Werkstoff für Fußböden
Entwicklung und Arten der Holzfußböden
Beanstandung – Mangel – Schaden
Schadensbilder aus der Praxis
Wertminderung